Rückblick…
Langsam brechen die letzten Wochen an bis zu meinem letzten Arbeitstag. Eigentlich sollte ich mich doch auf die neue, aufregende Zeit freuen, aber irgendwie kann ich das kaum. Ich fühle mich, als hätte ich Liebeskummer. Ich fühle mich traurig und ängstlich und irgendwie unendlich alleine, obwohl ich das überhaupt nicht bin. Alle meine Freunde, meine Familie und meine Kollegen sagen mir immer wieder, wie sehr sie mich vermissen werden und mir wird mehr und mehr bewusst, was es eigentlich bedeuten wird, mindestens 1 Jahr fort zu gehen, alleine.
Natürlich versuche ich mir nichts davon anmerken zu lassen und laufe weiterhin lächelnd zur Arbeit. Aber vor allem die Arbeit macht es mir immer schwerer. Als würde mir das Universum zeigen wollen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, wird es schlimmer und schlimmer. Wir haben immer einmal wieder Patienten bei uns, die über einen sehr langen Zeitraum bei uns sind, bis sie dann am Ende oftmals trotzdem versterben. Leider kommt es dann meistens dazu, dass einige unserer Pflegekräfte eine tiefe Bindung zu diesen Kindern aufbauen, meistens weil sie diese in der langen Zeit sehr häufig betreut haben. Man wird Teil des Lebens der Familien und umgekehrt werden sie ein Teil unseres. Und so kam es, dass ausgerechnet in meinen finalen Monaten mir genau so etwas passiert, intensiver als ich es mir jemals hätte vorstellen können und es kommt sogar so weit, dass ich kaum noch professionell bleiben kann in Bezug auf diese Patienten.
In dieser Zeit stoße ich ein letztes Mal an meine Grenzen, sowohl emotional, als auch körperlich, was wohl Hand in Hand geht. Ich betreue seit Wochen dieselben Patienten, fast jeden Tag. Ich führe lange, intensive Gespräche mit den Familien und da wir sehr viel Zeit miteinander verbringen, gute und auch schlechte Zeiten, nicht nur was die Patienten selbst, aber auch was die Situation auf unserer Station angeht, entstehen tiefe Bindungen zueinander. Wenn man soviel Zeit mit den gleichen Patienten und deren Angehörigen verbringt, ihnen beisteht bei jeder neuen schwierigen Herausforderung, ihnen Mut macht, sie aufbaut, sie sogar in den Arm nimmt, wenn es wieder 3 Schritte zurück geht und sich aber auch mit ihnen über Fortschritte freut bis einem Tränen in den Augen stehen, weil man so erleichtert ist, wird man Teil des Lebens des jeweils anderen. Bei keinem anderen Beruf entwickelt man so intime und manchmal enge Bindungen. Wir sind in den intimsten, schwierigsten, manchmal schönsten, gefährlichsten, dunkelsten und aufregendsten Momenten hautnah dabei, erster Ansprechpartner und Vertrauter. Oft müssen wir vermitteln zwischen Ärzten und den Angehörigen, müssen übersetzen was der jeweils andere ausdrücken wollte, entweder weil die Angehörigen das Ärztekaudawelch nicht verstehen oder weil die Ärzte nicht verstehen, was die Angehörigen ausdrücken möchten. Manchmal sprechen wir sogar aus, was uns Angehörige nicht einmal sagen müssen, weil wir ihre Ängste und Fragen spüren können und ihnen ersparen wollen, selbst den Mut und die Kraft aufzubringen, das vielleicht unaussprechlichste anzusprechen.
Genau zu solch einer Bindung kommt es in meinen letzten Monaten und ich selbst hätte nicht gedacht, dass mir so etwas so intensiv passieren könnte. Ich empfinde eine starke emotionale Bindung zu bestimmten Patienten und deren Familien und ich gebe alles, wirklich mehr als 100%, um den kleinen Patienten mehr als nur die beste Pflege von meiner Seite zukommen zu lassen. Was natürlich nicht funktioniert, da wir immer noch unterbesetzt sind und eben diese Patienten mit diejenigen sind, die die meiste Pflege und Aufmerksamkeit bedürfen. Das zu sagen ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich schwachsinnig, weil wir ausschließlich mittelschwere Katastrophen zu bewältigen haben, um es vorsichtig auszudrücken. Es kommt zu Momenten, in denen ich nicht wusste, ob ich hysterisch lachen soll oder in Tränen ausbrechen soll, obwohl ich für keine der beiden Gefühlsausbrüche auch nur eine Sekunde Zeit gehabt hätte. Aber wie soll man mit solchen Situationen umgehen, wenn man eine ganz spezielle Bindung zu seinen Patienten aufgebaut hat? Wenn man sich beinahe selbst wie ein Angehöriger fühlt? Ich spüre immer wieder Wut und Verzweiflung hochkochen, weil ich mir nicht mehr zu helfen weiß. Manchmal weiß ich gar nicht, wo mir der Kopf steht und ich habe selten auch nur eine Minute Zeit, um Luft zu holen. Ein Tag sollte mir ganz besonders im Gedächtnis bleiben, vielleicht mit der emotional anstrengendste und stressigste Dienst auf dieser Station. Während eine meiner Kolleginnen auf Transport ist, verschlechtert sich der Zustand ihres anderen Patienten drastisch, ein absoluter Alptraum für eine jede Pflegekraft, wie ich finde, da man keinerlei Kontrolle hat durch die eigene Abwesenheit und man darauf vertrauen muss, dass man die Kollegen gut genug informiert hat über seinen Patienten. Natürlich sind die Ärzte der Station sofort zur Stelle, können aber leider durch die Akutsituation nicht vom Bett des Patienten weg. Leider in genau diesen Stunden kommt es auch zu einer Art Akutsituation bei meinem Patienten, denn dieser soll eigentlich wach werden und seinen Tubus und die Beatmung verlieren, um seine kleinen Lungen zu trainieren. Während mein Patient also wach wird, stehen alle Ärzte fest bei dem anderen Patienten und ich kann nur verzweifelt dabei zusehen, wie mein Patient wacher und wacher wird und sich natürlich gegen die Beatmung wehrt. Ich weise die Ärzte mehrmals darauf hin, wohl wissend, dass niemand Zeit haben wird und frage, ob ich meinen Patienten wieder in einen tiefen Schlaf versetzen darf. Die Antwort meiner Kollegen trifft mich auf eine Weise, die ich kaum verkraften kann in diesem Moment. Das müsse er jetzt nun einmal aushalten für eine kurze Zeit! Aushalten? Und was soll ich bitte tun??? Mein Patient wehrt sich so sehr gegen den Schlauch in seiner Lunge (verständlich wie ich finde), dass auch er in eine lebensbedrohliche Situation rutschen könnte, was er auch immer wieder zu tun scheint. Ich nehme die Reaktion meiner Kollegin etwas zu persönlich auf in diesem Moment, was wohl an der stressigen Zeit auf der Arbeit in den vergangenen Wochen liegt und an dem zusätzlichen emotionalen Stress durch die intensive Bindung zu meinen Patienten und weiß mir nicht anders zu helfen, als für 5 Sekunden im Medikamentenraum zu verschwinden. Wie soll ich meinem kleinen Engel jetzt nur helfen? Was soll ich tun? Ich brauche einen Arzt nun an meiner Seite, weil ich nicht ohne einen Arzt den Schlauch entfernen kann, darf und möchte! Aber der Kleine kann nicht mehr länger warten und keiner hat Zeit durch die Notfallsituation. Ich versuche gegen die Tränen und den Kloß in meinem Hals anzukämpfen und atme tief ein und aus. Mehr Zeit bleibt mir auch schon nicht mehr, denn ich muss zurück zu meinem kleinen Kämpfer und seinem Vater, der die meiste Zeit bei ihm ist. Gott sei Dank ist auch er Intensivpfleger und hat Verständnis für unsere Situation und Gott sei Dank hilft ihm sein Wissen dabei, entspannt in den schlimmsten Diensten zu bleiben. Manchmal, so kommt es mir vor, scheint er entspannter zu sein als ich und so bin ich auch jetzt dankbar, dass er da ist. Seine Gelassenheit hat sich schon oftmals auf mich übertragen und mir geholfen!
Vollkommen aufgelöst und zerstreut erkläre ich ihm, dass es noch eine Weile dauert, bis die Ärzte Zeit haben und ich gerade in diesem Moment keine Ahnung habe, was ich tun soll. Traurig aber wahr, oftmals hatte er schon Ideen in solchen Situationen, die mir halfen, wenn ich vor lauter Stress nicht mehr klar denken konnte. Aber läuft nicht etwas verdammt verkehrt, wenn der Vater eines Patienten der Pflegekraft schon Tipps und Ideen in fast aussichtslosen Situationen geben muss, weil diese vor lauter Stress keinen geraden Gedanken mehr fassen kann? Sollte ich nicht umgekehrt seine Stütze sein, die Stütze für besorgte Angehörige? Die, die ihnen Mut macht oder manchmal einfach nur zuhört? Solche Momente zeigen mir, dass ich definitiv die richtige Entscheidung getroffen habe, diese Station zu verlassen. Oftmals sind die Situationen aussichtslos und auch wenn man denken sollte, dass in einer Notfallsituation ein Arzt oder ein anderer Kollege Zeit haben sollte, sieht die harte Realität leider anders aus. Und was soll man dann tun? Wie soll man so etwas aushalten können? Ich fühle mich an diesem Tag so verloren und hilflos, dass ich zwischenzeitlich nur verzweifelt auf den Monitor meiner Patienten starre, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, was ich tun soll.
Gott sei Dank kommt dann nach einer weiteren hilflosen halben Stunde, in der ich auf irgendeine Weise versuche, meine Patienten zu stabilisieren, der ärztliche Nachtdienst durch die Tür. Ich höre die Tür und renne raus, um denjenigen, der dort hindurch kommt, nichtsahnend und eigentlich noch entspannt, da seine Schicht offiziell erst in 20 Minuten beginnt, abzufangen und ihn in meiner Verzweiflung sofort zu meinem Patienten zu bitten. „Bitte, bitte hilf mir! Mein Patient ist schon hellwach und wehrt sich gegen seine Beatmung, was in seinem Zustand nicht optimal ist! Ich weiß nicht mehr weiter. Niemand hat Zeit. Wenn wir nicht JETZT etwas tun…“, flehe ich ihn an, kurz vor einem Nervenzusammenbruch und unfähig den Satz zu Ende zu bringen.
Am Ende des Dienstes, nach 2 Überstunden und obwohl ich am nächsten Tag wieder Frühdienst habe, sitze ich draußen mit meiner Kollegin, um auf Linda zu warten. Mir rauscht der Kopf, ich habe einen Mordshunger und mein Hals brennt, weil ich so durstig bin. Wie so oft hatten wir einen Dienst ohne Pause, ohne auch nur einen Schluck getrunken zu haben, nichts gegessen zu haben und nicht einmal die Zeit gehabt zu haben, zur Toilette zu gehen. Nachdem wir meinen Patienten endlich extubieren konnten, haben wir ihn nach nur wenigen Minuten wieder intubiert und wieder schlafen legen müssen, weil der ganze Tag einfach viel zu anstrengend für den kleinen Körper und seine kleinen, kranken Lungen war! Mein armer kleiner Spatz. Fast unter Tränen habe ich mich an diesem Abend noch ungefähr 100 Mal bei seinem Vater entschuldigt für diesen Dienst und den Stress, dem er und sein Sohn deshalb ausgesetzt waren. Wir kämpfen schon so lange, ihm zu helfen und eine Frage kommt mir immer wieder in den Sinn. Eine Frage, die ich nicht einmal wage laut auszusprechen, weil sie mir unendlich weh tut.
Die nächsten Tage sollten auch nicht besser werden. In meinen letzten Wochen sollte es tatsächlich noch zum Schlimmsten kommen, dass ich mir hätte ausmalen können… etwas wovor ich immer Angst hatte. Ich verliere in meinem letzten Monat zwei Patienten, die mir zu sehr ans Herz gewachsen sind. Nicht etwa gleichzeitig, sondern nacheinander. Monatelang haben wir alle mit den kleinen Engeln mit gekämpft, bis zur letzten Minute. Wir hatten Hoffnung, wo es doch kaum noch Hoffnung gab und wir haben immer wieder ein Licht am Ende des Tunnels sehen können, welches leider am Ende in zu weiter Entfernung blieb, unmöglich es zu erreichen. Oder haben wir uns nur lange genug eingeredet eines zu sehen, wo es eigentlich keines zu sehen gab?
Bei jedem unserer Sternenkinder kommt es zu Momenten, in denen distanzierte und professionelle Pflegekräfte sehen, dass man vergebens kämpft und dann können diese nur traurig dabei zusehen, wie Angehörige, sowohl als zu sehr involvierte Pflegekräfte und Ärzte immer wieder Hoffnung schöpfen, wo es eigentlich keine mehr gibt. Natürlich soll das auch so sein, es soll auch alles versucht und bis zum Schluss gekämpft werden, aber von außen betrachtet kann das sehr deprimierend sein, weil man das tragische Ende meist schon kennt.
Jetzt, wo ich selbst einmal auf der anderen Seite stehe, auf der Seite der emotional eingebundenen Pflegekräfte, erschrecke ich mich selbst, wie hart mich eben dieses Ende trifft. Es trifft mich mit einer solchen Wucht, dass ich tagelang nicht schlafen kann, immer wieder höre ich die Fragen und das Weinen der Eltern in meinen Ohren. Immer wieder frage ich mich, ob ich etwas hätte anders machen können und ob es am Ende sogar mein Fehler war. Totaler Quatsch natürlich, aber in meinem Kopf gehe ich immer und immer wieder die letzten Wochen durch und suche nach einer Antwort auf meine Frage. Die Frage nach dem Warum, auf die es einfach keine genaue Antwort gibt. Manche Kinder haben entweder schon vor Geburt, unerwartet während der Geburt oder nach der Geburt grauenvolle Bedingungen, Startschwierigkeiten wenn man es so nennen mag, und von uns bekommen sie eine Chance. Wir tun alles dafür, diesen unschuldigen, kleinen Wesen eine reelle Chance zu geben und kämpfen mit ihnen bis zum Schluss. Doch manche schaffen es einfach nicht, selbst wenn sie viele, viele Schritte nach vorne schaffen. Manchmal sind die Schritte, die sie zurückwerfen einfach doppelt so groß und am Ende kann der kleine Körper nicht mehr weiterkämpfen. Und meist gibt es niemanden, der daran Schuld hat! Kein Arzt, keine Pflegekraft und erst Recht keiner der Eltern!! Dann entscheiden sich die kleinen Kämpfer entweder, selbst loszulassen und zu gehen oder, meiner Meinung nach das Schlimmste, was eintreffen kann, müssen die Menschen, die sie am meisten lieben, sie loslassen und sie gehen lassen!
In den Fällen, die mich am tiefsten treffen zu der Zeit, müssen die Angehörigen die grausamste und schwierigste Entscheidung treffen. Eine aus einer Akutsituation heraus und eine, weil es einfach keine Hoffnung mehr gibt. Keine der beiden wirkt leichter als die andere. Wie denn auch? Wie könnte eine solche Entscheidung jemals leicht sein?
Bei einem der Patienten bin ich als zuständige Pflegekraft dabei. Ich übernehme den Patienten, als die Entscheidung getroffen wurde und sollte nun die Familie in dieser schwierigen Situation begleiten. Dieser Dienst ist nicht wie andere für mich. In diesem Dienst lasse ich mich nicht stressen. Ich blende alles um mich herum aus. Alle anderen Patienten. Dieser Dienst verläuft für mich wie in einem Tunnelblick. Ich versuche alles so schön wie möglich zu gestalten. Ich nehme mir soviel Zeit, wie die Familie braucht. Ich bin immer in der Nähe, immer bereit Fragen zu beantworten, eine Schulter zum Ausweinen zu bieten und ihnen jeden Wunsch nach Möglichkeit zu erfüllen. Für mich ist das erst die zweite Begleitung in meiner Zeit auf dieser Station. Wenig für unsere Verhältnisse, aber ich bin froh darum. Meine Empathie war mir immer meine liebste Charaktereigenschaft, aber in solchen Momenten zerreißt es mich förmlich, die Angehörigen so zu sehen. Auch in diesen Situationen trifft es wieder einmal zu, dass wir als Pflegekräfte in den intimsten Momenten des Lebens in erster Reihe stehen. Viele Menschen haben keine Ahnung von unserem Beruf und so wissen sie auch nicht, dass wir Menschen und ihre Angehörigen in ihren letzten Stunden und Minuten, sogar Sekunden begleiten. Und sie wissen auch nicht, dass unsere Arbeit auch darüber hinaus geht…
Die Sekunde, in der mein Patient in diesem Nachtdienst endlich erlöst wird und gehen darf, während er in den Armen seiner Eltern liegt, werde ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Nie werde ich die Schreie und das Weinen der Eltern vergessen, nie werde ich ihre verzweifelten Blicke vergessen, so hilflos und so voller Angst und Trauer. Nie werde ich meine ärztliche Kollegin vergessen, sie arbeitet zu dem Zeitpunkt noch nicht lange bei uns, wie sie mit Tränen in den Augen dabei zuzieht, wie ich den reglosen Körper wasche, wiege, vermesse und das süßeste Outift anziehe, dass ich finden konnte. Und nie werde ich das süße, kleine Gesicht vergessen, ohne Schläuche und ohne schmerzverzerrtes Gesicht, wie es nun für immer friedlich eingeschlafen ist. Der kleine Engel sieht so friedlich aus nun, wie in einem tiefen Schlaf und ich wünsche dem Kind die schönsten Träume, bevor ich es zudecke und den Raum verlasse, um mit den Ärzten den Papierkram zu besprechen.
Ich fühle mich ausgelaugt nach diesem Dienst. Emotional ausgelaugt. Nach Stunden, fast am Ende meines Dienstes, rufen mich die Eltern noch ein letztes Mal an. Sie sind aufgelöst und fragen, wo ihr Kind nun ist und ob es alleine ist. Ich sage ihnen, dass ihr Schatz noch bei uns ist und ich erst am Ende meines Dienstes das kleine Bettchen in die Kapelle fahre. Ich habe einen Kloß im Hals. Ich glaube nicht, dass sie bisher ein Auge zugemacht haben und ich weiß noch nicht, ob ich eines zumachen kann nach diesem Dienst.
Nur einige Tage nach diesem Dienst kommt es auch bei dem anderen Patienten, den ich so sehr in mein Herz geschlossen habe, zu dieser schrecklichen Situation. In diesem Dienst bin ich nicht auf der Station, aber Linda und ich werden angerufen von unseren Kollegen, weil sie wissen, wie sehr wir emotional eingebunden sind in diesen Fall. Ich war es zuletzt sogar so sehr, dass ich nach dem letzten Dienst, in dem alles drunter und drüber ging in der Extuabtionssituation, mich dazu entschieden habe, nur noch als Besucher an seinem Bett zu stehen und nicht mehr als zuständige Pflegekraft. Viel zu sehr hat mich diese Machtlosigkeit und Verzweiflung mitgenommen, viel zu sehr hat all das an meinen Kräften gezehrt. In jeder neu auftretenden Notfallsituation habe ich mich gefragt, ob ich einen Fehler gemacht habe und wurde zu hektisch, zu ängstlich ihn zu verlieren, so wie wir schon den anderen Patienten verloren hatten. Und nun sollte es tatsächlich soweit sein. Auch wenn wir wussten, dass es früher oder später soweit sein könnte oder würde, tut es nun nicht weniger weh, da es jetzt soweit ist. Wie konnte ich 2 Jahre in diesem Beruf arbeiten? Wie konnten manche Kollegen 10 Jahre oder länger auf dieser Station bleiben, ohne ins Burn Out zu gehen oder depressiv zu werden? Es ist nicht so, dass es nur solche Situationen gibt auf unserer Station. Natürlich gibt es auch wunderschöne Momente, Momente in denen ein Patient letztendlich doch gesund nach Hause gehen kann. Oder Momente, in denen frühere Patienten, die beinahe gestorben sind und deren Fälle aussichtslos erschienen, zu Besuch auf unsere Station kommen und mit großen Augen auf die Inkubatoren und Bettchen starren, in denen sie einst gelegen haben. Aber wie oft passiert das? Natürlich geben solche Momente Hoffnung und ja, sie zeigen vermutlich auch, dass es sich IMMER lohnt zu kämpfen, selbst wenn es noch so aussichtslos erscheint.
Aber in diesem Moment, nach diesem Anruf, weiß ich, ich gehöre nicht dorthin und dass ich so etwas nie wieder auf diese Art empfinden möchte. Verzweiflung, Wut, Trauer, Erleichterung, Liebe.
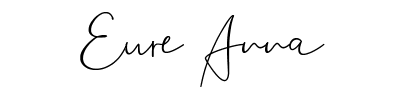


💕 lasst mir gern einen Kommentar da 💕